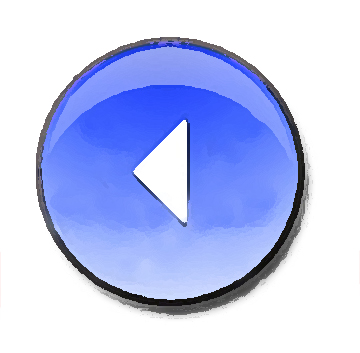
Phasen der Vasenmalerei
 Ab der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts bis zum Beginn des 5. Jahrhunderts v. Chr. wird mit der eigentlichen Schwarzfigurigen Vasenmalerei ein neuer Stil eingeführt. Menschliche Figuren werden vermehrt dargestellt. Die Kompositionsschemata ändern sich. Gelageszenen, Kampfszenen, mythologische Szenen aus dem Umkreis der Heraklessage und des Trojanischen Krieges sind beliebte Motive. Wie bereits in der Orientalisierenden Phase werden die Silhouetten der Figuren mit Schlicker oder Glanzton auf den ledertrockenen, ungebrannten Ton gemalt. Mit einem Stichel werden die feinen Details ausgeritzt. Der Halsbereich oder der Boden sind durch Muster gekennzeichnet wie u.a. durch Ranken-Palmetten-Ornamente. Beim Brennen wird der Grund rot, während der Glanzton eine schwarze Farbe erhält. Erstmals wurde von Korinth auch Weiß als Farbe eingesetzt, vor allem um die Haut weiblicher Figuren abzusetzen.
Auch andere keramische Produktionszentren, etwa Athen, übernahmen die Gestaltungsweise des von Korinth ausgehenden Stils in ihren Produkten. Athen übertrumpfte gar ab etwa 570 v. Chr. Korinth in der Qualität seiner Vasen und im Ausmaß der Produktion. Die entsprechenden Gefäße werden als attisch-schwarzfigurige Keramik angesprochen.
Erstmals lassen sich nun verschiedene Maler- und Töpferpersönlichkeiten fassen, die stolz ihre Werke zu signieren beginnen. Einer der bekanntesten Künstler dieser Zeit ist Exekias. Weitere Künstler von Bedeutung sind Pasiades und Chares. Ab 530 v. Chr. wird mit der Entwicklung des Rotfigurigen Stils der Schwarzfigurige Stil zunehmend bedeutungslos. Doch wurden die sogenannten Panathenäischen Preisamphoren, die bei sportlichen Wettkämpfen, den so genannten Panathenäen, an den Sieger vergeben wurden, auch im 5. Jahrhunderts v. Chr. weiter in schwarzfiguriger Technik ausgeführt. Am Ende des 4 Jahrhunderts v. Chr. erlebte der Stil sogar ein kurzes Revival in der etruskischen Vasenproduktion.
Ab der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts bis zum Beginn des 5. Jahrhunderts v. Chr. wird mit der eigentlichen Schwarzfigurigen Vasenmalerei ein neuer Stil eingeführt. Menschliche Figuren werden vermehrt dargestellt. Die Kompositionsschemata ändern sich. Gelageszenen, Kampfszenen, mythologische Szenen aus dem Umkreis der Heraklessage und des Trojanischen Krieges sind beliebte Motive. Wie bereits in der Orientalisierenden Phase werden die Silhouetten der Figuren mit Schlicker oder Glanzton auf den ledertrockenen, ungebrannten Ton gemalt. Mit einem Stichel werden die feinen Details ausgeritzt. Der Halsbereich oder der Boden sind durch Muster gekennzeichnet wie u.a. durch Ranken-Palmetten-Ornamente. Beim Brennen wird der Grund rot, während der Glanzton eine schwarze Farbe erhält. Erstmals wurde von Korinth auch Weiß als Farbe eingesetzt, vor allem um die Haut weiblicher Figuren abzusetzen.
Auch andere keramische Produktionszentren, etwa Athen, übernahmen die Gestaltungsweise des von Korinth ausgehenden Stils in ihren Produkten. Athen übertrumpfte gar ab etwa 570 v. Chr. Korinth in der Qualität seiner Vasen und im Ausmaß der Produktion. Die entsprechenden Gefäße werden als attisch-schwarzfigurige Keramik angesprochen.
Erstmals lassen sich nun verschiedene Maler- und Töpferpersönlichkeiten fassen, die stolz ihre Werke zu signieren beginnen. Einer der bekanntesten Künstler dieser Zeit ist Exekias. Weitere Künstler von Bedeutung sind Pasiades und Chares. Ab 530 v. Chr. wird mit der Entwicklung des Rotfigurigen Stils der Schwarzfigurige Stil zunehmend bedeutungslos. Doch wurden die sogenannten Panathenäischen Preisamphoren, die bei sportlichen Wettkämpfen, den so genannten Panathenäen, an den Sieger vergeben wurden, auch im 5. Jahrhunderts v. Chr. weiter in schwarzfiguriger Technik ausgeführt. Am Ende des 4 Jahrhunderts v. Chr. erlebte der Stil sogar ein kurzes Revival in der etruskischen Vasenproduktion.
 Um 530 v. Chr. wurden erstmals Vasen im rotfigurigen Stil produziert. Als Erfinder dieser Technik gilt gemeinhin der Andokides-Maler. In Umkehrung der zuvor gegebenen Farbgebung wurden nun nicht die schwarzen Figurensilhouetten aufgetragen, sondern der Hintergrund wurde geschwärzt, wobei die darzustellenden Figuren ausgespart wurden. Mit einzelnen Borsten konnten in die ausgesparten Figuren feinste Binnenzeichnungen gezogen werden. Unterschiedliche Konsistenzen des Schlickers erlaubten Abstufungen von Brauntönen. In der Anfangszeit des Stils wird noch mit diesen Gegensätzen gespielt, indem bilingue Vasen geschaffen wurden, die zu einem Teil in der schwarzfigurigen, und zum anderen Teil in der rotfigurigen Technik ausgeführt wurden.
Das ganze Spektrum mythologischer Szenen, aber auch Darstellungen aus dem Alltag, aus dem Leben der Frauen und Werkstätten kamen zur Anschauung. Komplizierte Darstellungen von Pferdegespannen, Architekturen, Dreiviertelansichten und Rückansichten wurden aufgeboten, um einen bislang nicht gekannten Realismus in die Darstellung zu bringen. Häufig werden nun die Signaturen von Malern, wenn auch die Töpfersignaturen noch überwiegen. epóiesen (es/er machte) bezeichnete für gewöhnlich den Töpfer, während die Maler mit égrapsen (es/er zeichnete) signierten. War der Töpfer auch der Maler konnten beide Floskeln vorkommen. Dank dieser Inschriften ließen sich viele Gefäße individuellen Malern zuordnen, über deren Werk und Entwicklung man dadurch einen gewissen Überblick erhält.
Bereits im 5. Jahrhundert v. Chr. entstanden in Unteritalien bedeutende Werkstätten, die diesen Stil nutzten und in Konkurrenz zu attischen Werkstätten traten. Auch andere versuchten diesen Stil zu kopieren, hatten damit aber meist nur lokale Bedeutung.
Um 530 v. Chr. wurden erstmals Vasen im rotfigurigen Stil produziert. Als Erfinder dieser Technik gilt gemeinhin der Andokides-Maler. In Umkehrung der zuvor gegebenen Farbgebung wurden nun nicht die schwarzen Figurensilhouetten aufgetragen, sondern der Hintergrund wurde geschwärzt, wobei die darzustellenden Figuren ausgespart wurden. Mit einzelnen Borsten konnten in die ausgesparten Figuren feinste Binnenzeichnungen gezogen werden. Unterschiedliche Konsistenzen des Schlickers erlaubten Abstufungen von Brauntönen. In der Anfangszeit des Stils wird noch mit diesen Gegensätzen gespielt, indem bilingue Vasen geschaffen wurden, die zu einem Teil in der schwarzfigurigen, und zum anderen Teil in der rotfigurigen Technik ausgeführt wurden.
Das ganze Spektrum mythologischer Szenen, aber auch Darstellungen aus dem Alltag, aus dem Leben der Frauen und Werkstätten kamen zur Anschauung. Komplizierte Darstellungen von Pferdegespannen, Architekturen, Dreiviertelansichten und Rückansichten wurden aufgeboten, um einen bislang nicht gekannten Realismus in die Darstellung zu bringen. Häufig werden nun die Signaturen von Malern, wenn auch die Töpfersignaturen noch überwiegen. epóiesen (es/er machte) bezeichnete für gewöhnlich den Töpfer, während die Maler mit égrapsen (es/er zeichnete) signierten. War der Töpfer auch der Maler konnten beide Floskeln vorkommen. Dank dieser Inschriften ließen sich viele Gefäße individuellen Malern zuordnen, über deren Werk und Entwicklung man dadurch einen gewissen Überblick erhält.
Bereits im 5. Jahrhundert v. Chr. entstanden in Unteritalien bedeutende Werkstätten, die diesen Stil nutzten und in Konkurrenz zu attischen Werkstätten traten. Auch andere versuchten diesen Stil zu kopieren, hatten damit aber meist nur lokale Bedeutung.